die berliner salons um 1800 (12 Ergebnisse)
FeedbackSuchfilter
Produktart
- Alle Product Types
- Bücher (12)
- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Manuskripte & Papierantiquitäten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
Zustand
Einband
Weitere Eigenschaften
- Erstausgabe (2)
- Signiert (1)
- Schutzumschlag (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Angebotsfoto (10)
Sprache (2)
Gratisversand
- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
Land des Verkäufers
Verkäuferbewertung
-
Königin Luise und Friedrich Wilhelm III. : eine Liebe in Preussen. Paare.
Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland
Erstausgabe Signiert
EUR 19,00
Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZustand: Gut. 1. Aufl. 207 S. : Ill. ; 21 cm; fadengeh. Orig.-Pappband m. OUmschl. Gutes Ex. - Titelblatt mit Widmung und SIGNIERT von Dagmar von Gersdorff. - Dagmar von Gersdorff, geb. von Forell (* 1938 in Trier) ist eine deutsche Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin. . (wiki) // . Die vorliegende Biographie stellt das Paar vor den späten Hintergrund der Französischen Revolution, in die hohe Zeit des deutschen Idealismus, der Berliner Salons, der preußischen Kriege und Reformen. . // INHALT : "Empfänglich für weibliche Anmuth und Reize" Fürstliche Heiratspläne --- "Ein Kuß besiegelte diesen Augenblick" Die Entscheidung zwischen zwei Schwestern --- "Kirschen und eine Schachtel mit Erdbeeren" Liebesbriefe --- "Was Würde und Macht ihm nicht geben können . Doppelhochzeit in Berlin. 1793 --- "Szenen ohne Ende" --- Streit in Berlin, Versöhnung in Potsdam. 1794 --- "Meine Prüfungszeit wird beginnen ." Die Stufen zum Thron. 1795 - 1797 --- "Eigentlich behandelte er sie ziemlich schlecht." Eine Königlich-Preußische Familie. 1797 -1799 --- "Glauben Sie an meine Freundschaft." Geselligkeit um 1800 --- "Mein Kopf läuft nicht mit meinem Herzen davon" --- Alexander von Rußland. 1802 --- "Warum mußte er sterben?" --- Ein Dichter und ein Kaiser in Berlin. 1803 -1805 --- "Überhaupt mehr Selbstvertrauen ." --- Die preußische Niederlage. 1806 --- "Nur Ausdauer und Widerstand können uns retten" Die Unterredung von Luise und Napoleon. 1807 --- (u.a.) ISBN 9783871342219 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 356.
-
Der Monat. Herausgeber: Fritz René Allemann und Hellmut Jaesrich. Heft 151.
Verlag: Berlin: Gesellschaft für internationale Publizistik, April 1961., 1961
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat Hans Höchtberger, München, Deutschland
EUR 6,00
Währung umrechnenEUR 18,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbOrig.-Heft. 4°. 96 S. Fischer/Dietzel 764. - Beiträge von Erich Goldhagen (Die Zukunft der kommunistischen Gesellschaft), Hans Gresmann (Meinungsforschung und Demokratie), Julio Cortázar (Bestiarium. Erzählung), Fritz René Allemann (Zwei Jahre Fidelismus auf Cuba. III), Hans Reinicke (Berliner Salons um 1800: Henriette Herz und Rahel Levin), Gert von Eynern (Die Weltbevölkerung darf nicht wachsen), Werner Hofmann (Der Maler Verlon. Mit 3 Abbildungen auf Tafeln), Dieter Stolte (Hannah Arendt), Richard Huelsenbeck (Dada war kein Bierulk!) u.a. - Gutes Exemplar. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 380.
-
Konnten jüdische Frauen mithilfe der Berliner Salons ihre soziale Situation verbessern?
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
EUR 16,95
Währung umrechnenEUR 28,22 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Länder - Mittelalter, Frühe Neuzeit, Note: 1,3, Universität Augsburg, Veranstaltung: Geschichte Europa Frühe Neuzeit, Sprache: Deutsch, Abstract: 1. Einleitung: Die Besonderheit der jüdischen SalonsDie Berliner Salons, die ihre Blütezeit um 1800, also in der Romantik, hatten, waren die ersten Sozietäten, die Frauen und Juden, wenn man von den jüdischen Gesellschaften Mendelssohns und Co. absieht, nicht ausschlossen. Sie wurden sogar von Frauen, zu einem großen Teil auch jüdischen Frauen, geleitet. Dabei galten selbst in der Aufklärungsperiode Frauen als zu unintelligent und Juden als zu verdorben und gottgläubig um an aufgeklärten Diskussionen teilnehmen zu können. Doch da viele Gelehrte und Männer hohen Standes diese jüdischen Salons besuchten, stellt sich die Frage, ob jüdische Frauen ihre soziale Stellung mithilfe der Berliner Salons verbessern konnten. Während ein Teil der Historiker die Salons als Grundstein der weiblichen Emanzipation ansahen, bemängelten andere, dass Salonfrauen kaum publizierten und somit nur als Musen der Männer betrachten werden können. Ebenso befürworteten einige Wissenschaftler den starken Assimilationsdrang vieler jüdischer Salondamen- und besucherinnen, wobei vor allem jüdische Historiker jedoch dieses Verhalten als Verrat an der jüdischen Gemeinde ansahen. Über die Quellenlage lässt sich sagen, dass es zwar keine offiziellen Dokumentationen der Berliner Salons gibt, doch zu dieser Zeit gab es einen regen Austausch von Briefen, auch über die Teilnahme an den Salons, und es wurden Tagebücher geschrieben, in denen die Eindrücke aus der Salongesellschaft schriftlich fixiert wurden. In meiner Ausarbeitung möchte ich zunächst an dem Beispiel der Rahel Levin aufzeigen, wie schwierig es für eine jüdische Frau zu dieser Zeit war, sich trotz der Bekanntschaft vieler bedeutender Persönlichkeiten in der christlich-deutschen Gesellschaft Akzeptanz zu verschaffen. Jedoch im darauffolgenden Kapitel werde ich dann die wohl effektivste Methode für eine Jüdin, in Berlin gesellschaftlich aufzusteigen, nämlich die Heirat eines Adligen, vorstellen. Diese Mischehen wurden durch die Salons begünstigt. Danach werden die Konzepte verschiedener Salonbesucher über deren Juden- und Frauenbild aufgezeigt, da diese Meinungen teilweise durch die Salons geprägt wurden und eine Resonanz der damaligen gesellschaftlichen Ansichten über jüdische Frauen bieten. Im vierten Kapitel wird schließlich das preußische Emanzipationsedikt erläutert, woraufhin die schriftstellerischen Tätigkeiten der jüdischen Salonfrauen analysiert werden.
-
EUR 17,95
Währung umrechnenEUR 28,36 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Geschichte - Sonstiges, Note: 1,0, Universität Siegen (Geschichte), Veranstaltung: Jüdisches Leben im 18. und 19. Jahrhundert in Deutschland, Sprache: Deutsch, Abstract: Rahel Levin wird am 19. Mai 1771 als ältestes Kind eines jüdischen Kaufmanns, Bankiers und Juweliers in Berlin geboren. Ihr folgen vier weitere Kinder. Die Familie Levin ist sehr wohlhabend und gehört zu den 500 Schutzjuden der jüdischen Oberschicht, die es zur Zeit Friedrich II. in Berlin gibt. Sie besitzen deshalb für Juden ungewöhnlich viele Rechte. Als 1790 jedoch Rahels Vater stirbt, gerät die Familie in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das Geschäft geht an Rahels Bruder Markus. Rahel kümmert sich um ihre kleineren Geschwister und übernimmt deren Erziehung, da sich ihre Mutter dazu nicht in der Lage fühlt. Rahel ist von ihrer Familie finanziell anhängig. 1790 eröffnet sie ihren ersten Salon im elterlichen Haus in der Dachstube. Er ist die Weiterführung der Abendgesellschaft des verstorbenen Vaters. In ihrem Salon treffen Menschen jeden Standes zusammen, um sich über Literatur, Natur und Kunst zu unterhalten. Unter den Gästen befinden sich auch bekannte Romantiker wie Brentano, Schleiermacher, die Gebrüder Humboldt und Tieck. Da Rahel schon in ihrer Jugend häufig krank ist, reist sie im Sommer 1795 zur Kur nach Teplitz.Im Winter lernt sie den Grafen von Finckenstein kennen. Die Beziehung scheitert jedoch trotz Verlobung nach fünf Jahren, da Rahel von seiner Familie nicht akzeptiert wird und Finckenstein nicht bereit ist, ein Doppelleben zu führen. Um sich abzulenken, fährt Rahel 1800 nach Paris und bleibt dort bis zum April 1801. 1802 lernt Rahel den spanischen Gesandtschaftssekretär Don Raphael d`Urquijo kennen und erlebt eine zweite unglückliche Liebesbeziehung. Schon nach eineinhalb Jahren erfolgt der Bruch. Als sie 1806, aufgrund Napoleons Einzugs in Berlin, ihren ersten Salon auflösen muss, geht es auch ihrer Familie finanziell immer schlechter. Rahel muss ihren Lebensstandard einschränken. 1808 lernt sie ihren zukünftigen Mann Karl August Varnhagen kennen, der jedoch schon bald zu einem Medizinstudium in eine andere Stadt aufbricht. Zudem zieht Rahel als nun 37- jährige nach schweren Konflikten mit ihrer Mutter aus der gemeinsamen Wohnung aus und mietet sich eine eigene. Nach der Krankheit und dem Tod ihrer Mutter 1809, zieht sie 1810 erneut um und ändert ihren Familiennamen. Von nun an nennt sie sich Robert (vgl. auch Gründe für ihren Religionswechsel). Als Preußen Frankreich 1813 den Krieg erklärt, reist Rahel nach Prag. Dort lebt sie wieder auf, denn alles ist neu und fremd für sie.
-
Briefe an den Bruder Ludwig. Hg, Renata Dampc-Jaros / Hannelore Scholz-Lübbering.
Verlag: Köln: Böhlau 2020., 2020
Anbieter: Antiquariat Bergische Bücherstube Mewes, Overath, Deutschland
EUR 29,00
Währung umrechnenEUR 39,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorb174 S. Kart. *neuwertg*. Die Edition bietet 41 bisher nicht publizierte Briefe von Sophie Tieck-Bernhardi-Knorring an ihren Bruder, den »König der Romantik« Ludwig Tieck. Sie fokussiert dabei primär auf den Bruder, um in ständigem Bezug auf ihn die Lebens- und Werkstationen der Schriftstellerin Sophie plastisch hervortreten zu lassen. Die Briefe sind in den Jahren 1792 bis 1831 entstanden. Es handelt sich dabei um einen privaten, »geschlossenen« Briefkorpus im Gegensatz zu den »offenen« Briefen, die im Freundeskreis oder in den Salons vorgelesen und diskutiert wurden. In Sophies Briefen artikuliert sie ihre Sorgen, Nöte, Ängste und Wünsche, die sie als Autodidaktin im Berliner Kulturleben um 1800 bewegten, war sie doch als Angehörige des niederen Standes von gediegener Bildung ausgeschlossen. Für sie wurde der Briefwechsel mit dem geliebten Bruder eine wichtige Brücke zur Schriftstellerei. Wir erleben so die Genese einer bedeutenden Autorin der literarischen Romantik, die neben unzähligen Briefen auch Erzählungen, Romane, Dramen und Gedichte verfasste.
-
Geselligkeit und Gesellige : Bildungsbürgertum und bildungsbürgerliche Kultur um 1800.
Verlag: Stuttgart ; Weimar : Metzler, 1998
ISBN 10: 3476452034 ISBN 13: 9783476452030
Sprache: Deutsch
Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland
EUR 45,00
Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorbkart. Zustand: Gut. 502 S. ; 21 cm Sauber erhalten. I. Einleitung 15 1. Literaturlage und Forschungsstand 15 2. Problemstellung 25 II. Geselligkeit. Theoretische Reflexionen 51 1. Einleitung 51 2. Systematisch-historische Begriffsannäherung 51 2.1. Geselligkeit. Soziologische Annäherungen 52 2.1.1. Kooptation und Kooperation 52 2.1.2. Schönheit und Lebensnotdurft 52 2.1.3. Form und Stoff 53 J2.1.4. Zusammenfassung 54 ^ 2.2. Geselligkeit. Historische Annäherungen 55 2.2.1. Von der Antike bis zum Ende des Mittelalters 56 2.2.2. Renaissance: Die Wiederentdeckung der Anmut 56 2.2.3. Barock: Das Ideal der Klugheit 57 2.2.4. Französische Klassik: Das Ideal der Höflichkeit 58 2.2.5. Bürgerliche Aufklärung: Das Ideal der Offenheit 58 2.2.6. Spätaufklärung: Das Ideal der Urbanität 60 \ 2.2.7. Zusammenfassung 61 3. Geselligkeit als Utopie in Schleiermachers Versuch einer Theorie des geselligen Betragens" 61 3.1. Publizistischer und diskursiver Hintergrund 62 3.2. Textrekonstruktion 64 3.2.1. Ausgangspunkt der Interpretation 65 3.2.2. Schleiermachers Ausgangsfrage 66 3.2.2.1. Schleiermachers Methode 67 3.2.2.2. Schleiermachers Erkenntnisgewinn 68 3.2.3. Das Entfremdungspotential der Erwerbsarbeit 69 3.2.4. Das Entfremdungspotential der Privatheit 70 3.2.5. Der kulturkritische Zusammenhang 70 3.2.5.1. Schiller 71 3.2.5.2. Schlegel 72 3.2.5.3. Zusammenfassung 73 3.2.6. Schleiermachers Neukonstruktion des Geselligkeitsbegriffes 74 3.2.7. Problematisierung I: Natürliche und moralische Tendenz geselliger Kommunikation 77 3.2.7.1. Formaler und materialer Aspekt von Kommunikation 78 3.2.7.2. Materiales Gesetz: Die Kommunizierbarkeit von Ideen und Gefühlen 79 3.2.7.3. Formelles Gesetz: Traditionsabbrüche und < kommunikatives Ethos 83 3.2.7.4. Zusammenfassung 86 3.2.8. Problematisierung II: Geselligkeit im engeren Sinne 87 3.2.8.1. Gemeinschaft der Geselligkeit 93 3.2.8.2. Das Wirkliche und das Mögliehe 93 3.2.8.3. Zusammenfassung 97 3.2.9. Problematisierung HI: Geselligkeit im weiteren Sinne 98 3.2.9.1. Der gesellige Kommunikationsraum 98 3.2.9.2. Salonrealität und liturgisches Geselligkeitsideal 100 3.2.9.3. Geselligkeit als Utopie 103 3.3. Die Grenzen der Geselligkeitsutopie 105 3.3.1. Geteilter Erfahrungshorizont und Lebensstil als Voraussetzung gelingender Geselligkeit 106 3.3.2. Die soziale Begrenztheit von Schleiermachers Versuch" 109 4. Schluß 112 III. Berliner Salons. Sozialgeschichtliche Rekonstruktionen 115 1. Einleitung 115 2. Salons - Begriffliche Annäherungen 115 2.1. Historische Schlaglichter 116 2.2. Die Berliner Salons der klassischen Periode 120 2.3. Die Salonieren 126 3. Bedingungsgefüge der Berliner Salons um 1800 145 3.1. Salons und Gesellschaften 145 3.2. Salons und Judentum 151 3.2.1. Historische und ökonomische Schlaglichter 152 3.2.2. Neuorientierungen 159 3.2.3. Das Ganze Haus" 162 \x 3.2.4. Traditionsabbrüche 166y 3.2.5. Zusammenfassung 170 3.3. Salons und Aristokratie 171 3.3.1. Historische und ökonomische Schlaglichter 172 3.3.2. Das Palais 175 3.3.3. Zusammenfassung 178 3.4. Salons und Urbanität 178 3.4.1. Definitorische Abgrenzungen 179 3.4.2. Objektive Potentiale einer Salonentwicklung 182 3.4.3. Subjektive Verarbeitungen der Großstadtwahrnehmung 196 3.4.4. Zusammenfassung 204 4. Berliner Salons um 1800 - Historikerkonstrukt oder historische Realität? 207 4.1. Historische und ökonomische Schlaglichter 207 4.2. Infrastruktur und salongeselliger Stil 212 5. Schluß 217 IV. Die Salongäste 219 1. Einleitung 219 2. Die empirische Basis 221 3. Die Salongäste als Gruppe 223 3. Alter, Generationenzusammenhang und Denkstil 227 3.1. Ergebnisse 227 3.2. Interpretation 230 3.2.1. Der Generationenansatz Karl Mannheims 231 3.2.2. Konstituenten des Generationenzusammenhanges der Salongäste, 237 3.3. Zusammenfassung 243 4. Verzeitlichung des Salonbegriffs 244 5. Spezifische Lebens- und Problemlagen 248 5.1. Frauen in den Salons 248 5.2. Juden in den Salons 254 5.3. Zusammenfassung 257 6. Soziale Schichtung in den Salons 258 6.1. Problemstellung 258 6.2. Operationalisierung 259 6.3. Herkunft der Salongäste und deren eigener Status bei Saloneintritt 260 6.3.1. Die Oberschicht" 261 6.3.2. Die Mittelschicht" 266 6.3.3. Interpretation 269 6.5. Akademiker in den Salons 275 6.6. Autoren und Künstler in den Salons 282 6.6.1. Künstlerische Betätigung der Salongäste 283 6.6.2. Interpretation 289 6.6.3. Resümee 297 6.7. Zusammenfassung V. Berliner Salongeselligkeit. Literarische Reflexe 303 1. Einleitung 303 2. Die Salons in literarischen Zeitzeugnissen 304 2.1. Die Salonieren 304 2.1.1. Die literarischen Zeugnisse 304 2.1.2. Interpretation 313 2.2. Die Salongäste 320 2.2.1. Die literarischen Zeugnisse 320 2.2.2. Interpretation 322 2.3. Zusammenfassung 329 3. Der Salongeschmack 330 3.1. Die mittlere Kommunikationslage 330 3.2. Der mittlere Geschmack 333 3.3. Zusammenfassung 337 4. Die Salongeselligkeit als ästhetische Inszenierung 337 . Die Theatralisierung von Geselligkeit 339 .1. Der Tee 339 .2. Die Miene 342 .3. Der Auftritt 343 .4. Interpretation 349 4.2. Die Theatralisierung von Literatur 351 4.2.1. Die literarischen Zeugnisse 352 4.2.2. Interpretation 357 4.3. Zusammenfassung 359 5. Schluß 359 VI. Schlußwort 363 Anhang I 375 Anhang II 433 Anhang III 439 Anhang IV 465 Literaturverzeichnis ISBN 9783476452030 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 749.
-
Kennen Sie Preußen - wirklich?: Das Zentrum "Preußen-Berlin" stellt sich vor [Gebundene Ausgabe] Bärbel Holtz (Herausgeber), Wolfgang Neugebauer (Herausgeber)
Anbieter: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, Deutschland
EUR 39,49
Währung umrechnenEUR 29,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbHardcover. Zustand: gut. 2009. Das 2007 an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften gegründete Zentrum »PreußenBerlin« vereinigt mehrere Forschungsprojekte, die sich in unterschiedlicher fachlicher Perspektive mit der Geschichte und Kultur Preußens befassen. Erforscht werden Leben und Werk bedeutender Repräsentanten preußischer Wissenschaft und Kultur, Berlin als Großstadtkultur in Deutschland um 1800 sowie das kulturstaatliche Handeln des preußischen Staates. In seiner ersten öffentlichen Veranstaltung lud das Zentrum in den Salon Sophie Charlotte der Akademie ein und stellte das Thema »Preußen« gemeinsam mit auswärtigen Wissenschaftlern und Künstlern in einem vielseitigen Programm vor. Der Band enthält die elf wissenschaftlichen Vorträge dieses Salons, die sich in einer breiten Themenpalette der Geschichte, Kultur wie Geselligkeit Preußens und Berlins seit dem späten 18. Jahrhundert widmen. Aus dem Inhalt: Wolfgang Neugebauer: Preußen - seine Kultur und die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Klaus Garber: Schwellenzeit. Das untergegangene alte Königsberg um 1800 Petra Wilhelmy-Dollinger: »Häuser ohne Frauen sind Verse ohne Poesie«. Berliner Salons vor und um 1800 Christian Filips: »Die Sprache der Engel« - Die Kunstreligion der Sing-Akademie zu Berlin um 1800 und ihre Wirkung auf Wackenroder und E. T. A. Hoffmann Conrad Wiedemann: Die wilden Lebensläufe von Berlin Claudia Sedlarz: Unter den Linden Nr. 38. Das Akademiegebäude und seine Nutzung Bärbel Holtz: Der »Erfinder« von Preußens Kunstpolitik - Franz Theodor Kugler Andreas Arndt: Schleiermachers Theorie der Geselligkeit Ingo Schwarz: Alexander von Humboldt als Publizist Ute Tintemann: Von Tegel bis Santiago de Chile. Wilhelm von Humboldts Netzwerke Christof Wingertszahn: Moritzens Musterbriefe In deutscher Sprache. 202 pages. 24,4 x 17,6 x 1,8 cm.
-
Berliner Salons und Londoner Kaffeehäuser im Vergleich (1780-1830)
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
EUR 47,95
Währung umrechnenEUR 28,75 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Examensarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Länder - Neuzeit, Absolutismus, Industrialisierung, Note: 1,3, Humboldt-Universität zu Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: 'Geselligkeit ist über die gesamte europäische Kulturgeschichte hinweg ein menschliches Grundbedürfnis gewesen.' [.]Berlin um 1800 war bestimmt von kulturellen und politischen Umbrüchen. Das Aufkommen einer Nationalliteratur und die napoleonische Besatzung prägten die Entwicklungen der Stadt nachhaltig. Diese unruhige Zeit ebnete den Weg für die Salons der Henriette Herz und Rahel Levin Varnhagen.Die Londoner Kaffeehäuser kristallisierten sich bereits 100 Jahre zuvor ebenfalls im Zuge von politischen Umbrüchen, z.B. denen der Glorreichen Revolution 1688, heraus. Beide Erscheinungen werden in dieser Arbeit gegenübergestellt. Dazu wird die Technik des historischen Vergleichs herangezogen, wobei zuerst die Berliner Salons und im Anschluss daran die Londoner Kaffeehäuser genauer betrachtet werden. Die Berliner Salons werden dabei deutlich ausführlicher untersucht, da sich aus dieser Thematik vergleichsweise mehr Problemfelder ergeben werden, welche eine intensivere Auseinandersetzung erfordern.Der dem Thema zugrundegelegte Zeitraum von 1780 bis 1830 bezieht sich in erster Linie auf die Berliner Salonkultur. Die Blütezeit der Londoner Kaffeehäuser ist ungefähr in der Zeit zwischen 1680 und 1729 anzusiedeln. Trotz der zeitlichen Diskrepanz soll hier der Versuch unternommen werden, die beiden kulturellen Phänomene miteinander zu vergleichen.[.]In Kapitel VI werden dann die Erkenntnisse der Untersuchungen zu den Berliner Salons und den Londoner Kaffeehäusern in dem Versuch einer Synthese zusammengeführt.Im Zentrum der Untersuchung der Salon- und Kaffeehauskultur stehen Fragen bezüglich der Bedingungsfaktoren der Entstehung der Institutionen, des aufkommenden literarischen und kulturellen Interesses des Besucher hinsichtlich eines gemeinsamen Austausches sowie der sozialen Zusammensetzung des Publikums. Die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden steht dabei im Mittelpunkt des Interesses.[.]Weiterhin sollen beide Einrichtungen hinsichtlich ihrer Position zwischen Privatheit und Öffentlichkeit untersucht werden. So empfingen die Salonnièren ihre Besucher in ihren privaten Häusern, die Kaffeehausbesucher hingegen verließen diese zwecks des geselligen Austausches. [.]Über alldem schwebt zusätzlich die Frage danach, inwiefern die beiden Thematiken überhaupt vergleichbar sind. [.].
-
Der großbürgerliche Salon 1850-1918 : Geselligkeit und Wohnkultur. Diss.
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
EUR 52,00
Währung umrechnenEUR 32,29 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar
In den WarenkorbBuch. Zustand: Neu. Neuware - Der Salon als Diskussionsforum für Literatur, Kunst und Gesellschaft erlebt im sogenannten Medienzeitalter eine Renaissance. Dabei dürfte der Reiz der unmittelbaren Kommunikation ebenso motivierend sein wie die Möglichkeit, über einen Salon Kontakte unterschiedlicher Art knüpfen zu können.Die Forschung konzentriert sich hauptsächlich auf die von jungen jüdischen Frauen etablierten Berliner Gesellschaften um 1800. Eine Periode, die als Höhepunkt deutscher Salonkultur gilt. Nicht weniger Beachtung verdient - gerade aus kunsthistorischer Sicht - die Geselligkeit der zweiten Hälfte das 19. Jahrhunderts. In dieser Zeit wird der von Gästen aus verschiedenen Schichten frequentierte Salon von der Berliner Bourgeoisie für den sozialen Aufstieg instrumentalisiert. Mit wachsender Bedeutung der Repräsentation verlagert sich die Kommunikation in den visuellen Bereich. Der Autor untersucht den Wandel des Salons und seine Spiegelung im Interieur: die Rolle des Salons, um sich einen Platz in der Gesellschaft zu erobern, die Rolle der Frau als Salonherrin, vor allem die Bedeutung der Salonausstattung, seinen Stilpluralismus, der sich in einer Vielfalt von Farben, Formen uns Stoffen ausdrückt, von der Jardiniere bis zum Paravant, vom Springbrunnen bis zum Kronleuchter: Salonmöblierung als Spiegelbild einer in Auflösung begriffenen Gesellschaft. Damit bietet der Autor eine Neubewertung der heute wieder vielfach zitierten Wohnkultur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
-
Geselligkeit und Gesellige. Bildung, Bürgertum und bildungsbürgerliche Kultur um 1800.
Verlag: J.B. Metzler, Stuttgart 1998., 1998
ISBN 10: 3476452034 ISBN 13: 9783476452030
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat Carl Wegner, Berlin, B, Deutschland
Verbandsmitglied: GIAQ
Erstausgabe
EUR 72,00
Währung umrechnenEUR 9,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbHardcover. 21 x 14,8 cm. Farbige Original-Broschur. 502 Seiten mit Literarischen Zeugnissen, Literaturverzeichnis und Anhängen. Eintragungsfreies, gutes Exemplar. Hauptkapitel: Einleitung / Geselligkeit, Theoretische Reflexionen / Berliner Salons, Sozialgeschichtliche Rekonstruktionen / Die Salongäste / Berliner Salongeselligkeit, Literarische Reflexe / Schlusswort / Anhänge. -- Bitte Portokosten außerhalb EU erfragen! / Please ask for postage costs outside EU! / S ' il vous plait demander des frais de port en dehors de l ' UE! -- Genießen Sie den Frühling mit einem guten Buch ! Sozio.
-
Rahel Levin Varnhagen : Rezeption - Projektion - Imagination
Verlag: De Gruyter Oldenbourg Sep 2024, 2024
ISBN 10: 3111342840 ISBN 13: 9783111342849
Sprache: Deutsch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
EUR 114,95
Währung umrechnenEUR 30,31 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbBuch. Zustand: Neu. Neuware - Saloniere, Autorin, Symbol weiblicher und jüdischer Emanzipation, Paria oder Parvenü Rahel Levin Varnhagen (1771-1833) kann als eine der meist zitierten und diskutierten deutschsprachigen Frauen gelten. Zu Lebzeiten ebenso bewundert wie umstritten, wurde sie im 19. und 20. Jahrhundert zur Symbolfigur für die Umbruchszeit um 1800, für das 'deutsch-jüdische Gespräch' bzw. Akkulturationsprozesse der Moderne und damit - je nach der Perspektive der Betrachtenden - zur Heldin oder Verliererin der Emanzipation. Trotz dieser schillernden Wirkungsgeschichte gibt es bis heute keine systematische Aufarbeitung der Rezeption weder der so genannten Berliner Salons noch ihrer berühmtesten Protagonistin.Dieser interdisziplinäre Band bündelt multiperspektivisch Rezeptionsgeschichte(n) aus zwei Jahrhunderten und eröffnet über die unterschiedlichen Identifikationen und Selbstverständigungsprozesse neue Zugänge zur europäisch-jüdischen Kulturgeschichte.
-
Der Berliner ¿jüdische Salon¿ um 1800 : Emanzipation in der Debatte
Verlag: De Gruyter, Mercury Learning And Information, 2012
ISBN 10: 3110271400 ISBN 13: 9783110271409
Sprache: Deutsch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
EUR 179,95
Währung umrechnenEUR 33,25 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbBuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Präsentiert werden die Berliner 'jüdischen Salons' um 1800 anhand neuer Quellen als ebenso lebendiges wie fragiles kommunikatives Netz. Der Querschnitt durch die Salongesellschaft des Beispieljahres 1794/95 macht eine Geselligkeitskultur sichtbar, in der sehr verschiedene Orte zu 'Salons' werden konnten, und in der Gäste und Gastgeberinnen (wieder) zu entdecken sind. Längsschnitte durch rekonstruierte, jahrzehntelang geführte Korrespondenzen erlauben die Frage nach Wendepunkten in der Wahrnehmung jüdischer Gastgeberinnen und nach möglichen Wechselwirkungen zwischen Salons und zeitgenössischen Emanzipationsdiskursen.


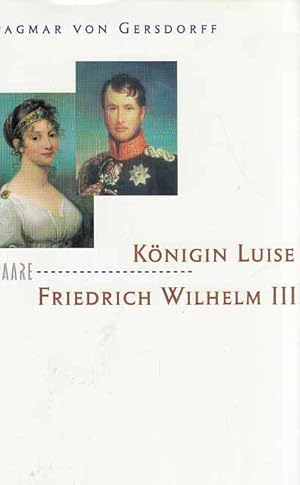




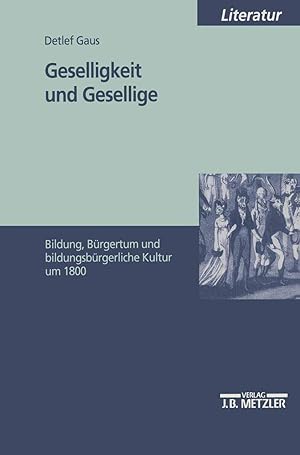
![Beispielbild für Kennen Sie Preußen - wirklich?: Das Zentrum "Preußen-Berlin" stellt sich vor [Gebundene Ausgabe] Bärbel Holtz (Herausgeber), Wolfgang Neugebauer (Herausgeber) zum Verkauf von BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer](https://pictures.abebooks.com/isbn/9783050046556-de-300.jpg)




