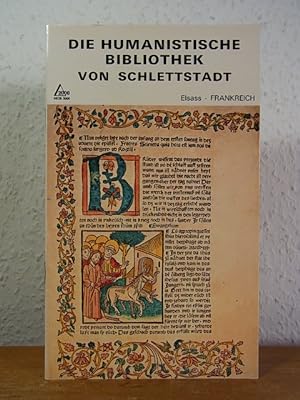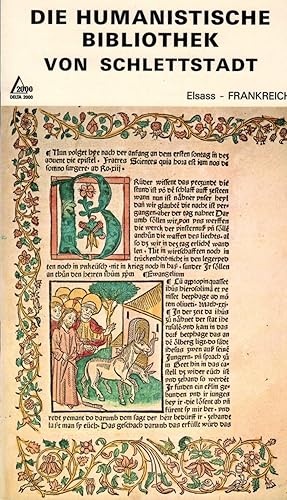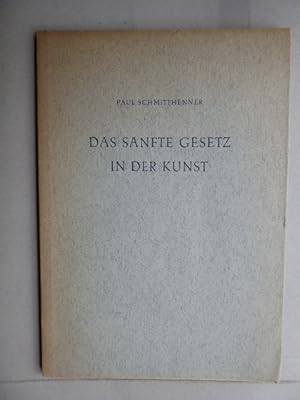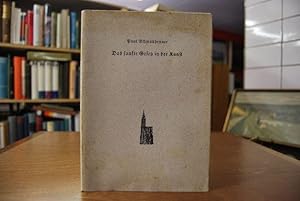schlettstadt humanistische (7 Ergebnisse)
FeedbackSuchfilter
Produktart
- Alle Product Types
- Bücher (7)
- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Manuskripte & Papierantiquitäten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
Zustand
Einband
Weitere Eigenschaften
- Erstausgabe (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Signiert (1)
- Schutzumschlag (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Angebotsfoto (7)
Sprache (2)
Gratisversand
- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
Land des Verkäufers
Verkäuferbewertung
-
Die Humanistische Bibliothek von Schlettstadt, Elsass, Frankreich
Verlag: Ingersheim: S.A.E.P., 1991
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat Weber, Neuendorf b. Elmshorn, SH, Deutschland
Verbandsmitglied: GIAQ
EUR 6,50
Währung umrechnenEUR 6,50 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorb21,5 x 13 cm ; kart. ; Zustand: Gut. 16 S. ; 22 cm Softcover, 16 Seiten mit zahlreichen farbigen Abbildungen. Gutes Exemplar. pwB29.
-
Die Humanistische Bibliothek von Schlettstadt, Elsass, Frankreich
Verlag: Ingersheim: S.A.E.P., 1983
Anbieter: Roland Antiquariat UG haftungsbeschränkt, Weinheim, Deutschland
EUR 5,87
Währung umrechnenEUR 14,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbSoftcover/Paperback. 16 S. 16 S., kt. (1983). Innen wie außen ein sehr gutes Exemplar. Einband und Leseseiten sind sauber und ohne Anstreichungen. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 205.
-
Die humanistische Bibliothek von Schlettstadt
Verlag: Colmar, 1983
Sprache: Deutsch
Anbieter: Paderbuch e.Kfm. Inh. Ralf R. Eichmann, Bad Lippspringe, NRW, Deutschland
EUR 12,00
Währung umrechnenEUR 8,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPerfect. Zustand: Good. Hubert Meyer: Die humanistische Bibliothek von Schlettstadt (Elsass - Frankreich). Deutsche Ausgabe. Imprimerie S.A.E.P. Ingersheim, Colmar 1983. Broschur, 16 Seiten mit Abbildungen; ordentlicher Zustand.
-
Der Humanismus zu Schlettstadt. Die Schule Die Humanisten Die Bibliothek. Aus dem Französischen übertragen von Professor Peter Schäfer. / Vorwort von Fr. Maurice Kubler / Maire honoraire de Selestat / President des Amis de la Bibliotheque Humaniste
Verlag: Schlettstadt ohne Verlag ohne Jahr.
ISBN 10: 2950825613 ISBN 13: 9782950825612
Sprache: Deutsch
Anbieter: Chiemgauer Internet Antiquariat GbR, Altenmarkt, BAY, Deutschland
EUR 24,00
Währung umrechnenEUR 11,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbOriginalbroschur. 19cm. Zustand: Sehr gut. Deutsche ERSTAUSGABE. 96 Seiten; Mit zahlreichen Schwarz-Weiß- Abbildungen. Der Vorderdeckel mit kleinen schwarzen Pünkten ( Fliegen!) Sonstfrisches schönes Exemplar. BEILIEGT: Farbiger Flyer Die Humanistische Bibliothek von Schlettstadt. 16 Seiten. Mit zahlreichen farbigen Abbildungen. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 240.
-
Das sanfte Gesetz in der Kunst (in Sondereinheit in der Baukunst).
Verlag: Stuttgart. Karl Krämer Verlag, 1954
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat Heinzelmännchen, Stuttgart, Deutschland
EUR 28,00
Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorb(2. Auflage mit Abbildungen). 60, (2) Seiten und 12 Abbildungen auf 12 Kunstdrucktafeln. Originalbroschur. (Einband randgebräunt. Ansonsten gutes Exemp.ar). 21x15 cm * Selten ! --- Paul Schmitthenner (* 15. Dezember 1884 in Lauterburg im Elsass, Deutsches Reich; 11. November 1972 in München) war ein deutscher Architekt und einflussreicher Hochschullehrer. Er zählt neben Paul Bonatz zu den Hauptvertretern der Stuttgarter Schule, der Heimatschutzarchitektur und international gesehen zur Architekturströmung des Traditionalismus. Schmitthenner wurde 1884 in Lauterburg im Elsass geboren. 1889 zog die Familie nach Barr im Elsass. Anschließend besuchte er das humanistische Gymnasium in Schlettstadt. Er studierte von 1902 bis 1907 Architektur an der Technischen Hochschule Karlsruhe und an der Technischen Hochschule München. Während seines Studiums wurde er 1902 Mitglied der Karlsruher Burschenschaft Ghibellinia. Bis 1909 arbeitete er beim Hochbauamt in Colmar (Elsass), von 1909 bis 1911 im Büro des Architekten Richard Riemerschmid in München. 1911 bis 1913 war er erstmals in selbstständiger Tätigkeit leitender Architekt der Gartenstadt Carlowitz bei Breslau. Von 1913 bis 1918 führte er, unterbrochen durch Kriegsdienst und Dienst beim Chef der Zivilverwaltung zur Organisation der Kurland-Schau", städtebauliche Planungen der Gartenstädte in Staaken, Plaue bei Brandenburg und Forstfeld bei Kassel für das Reichsamt des Inneren durch. Er machte dabei seit 1913 den Bau von Volkswohnungen" zu seinem Anliegen. Sein Konzept der Gartenstadt" überzeugte die Fachwelt durch besondere Qualitäten der räumlichen Anlage und der Hausformen. Der Wert des ebenerdigen Wohnens mit Arbeitsflächen und Ruhezonen im Garten wurde erkannt und herausgestellt. Schmitthenner publizierte in der Folgezeit vielfach über die deutsche Volkswohnung", die gesund und preiswert sowie mit handwerklich gut gestaltetem und kostengünstigem Mobiliar ausgestattet sein sollte. In seine Schriften flossen dabei sowohl bodenreformerische Thesen als auch erste Leitgedanken zum ökologischen Bauen seines Vorbildes Theodor Fischer mit ein. 1918 wurde er durch Paul Bonatz als Professor für Baukonstruktion und Entwerfen an die Technische Hochschule Stuttgart berufen. Zwischen den beiden Weltkriegen war er Vertreter der ersten" Stuttgarter Schule. 1928 war er Mitbegründer der Architektenvereinigung Der Block konservative Architekten im Unterschied zu dem 1924 von führenden Vertretern der Moderne gegründeten Der Ring. 1931 wurde er Ehrendoktor der Technischen Hochschule Dresden, Mitglied der Preußischen Akademie der Künste Berlin und der Akademie der bildenden Künste Wien sowie der Kunstakademie München. 1932 veröffentlichte Schmitthenner das Buch Das deutsche Wohnhaus". 1933 trat Schmitthenner der NSDAP bei und wurde nach Berlin berufen, wo er die Staatshochschule für Kunst leiten, eine Professur an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg innehaben und das Referat für Kunsterziehung im Reichsministerium besetzen sollte. Kurzzeitig galt er als erster Baumeister des nationalsozialistischen Staates, lehnte dann jedoch den Ruf ab und geriet in Opposition zur Partei. 1941 wandte er sich mit seinem kritischen Vortrag Das sanfte Gesetz in der Kunst, in Sonderheit in der Baukunst von der gängigen Monumentalarchitektur ab. 1944 siedelte er nach Zerstörung seines Wohnhauses auf dem Killesberg und der Technischen Hochschule Stuttgart in einen Seitenflügel von Schloss Kilchberg bei Tübingen um, wo er weiter universitäre Vorlesungen hielt. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs nahm ihn Adolf Hitler im August 1944 in die Gottbegnadeten-Liste der wichtigsten Architekten auf, was ihn von einem Kriegseinsatz, auch an der Heimatfront, befreite. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er auf Befehl der amerikanischen Militärregierung aus dem Staatsdienst entlassen. 1947 wurde er vor einer Spruchkammer als Entlasteter freigesprochen, die Wiedereinsetzung in sein Hochschulamt scheiterte jedoch. Ab 1949 war Schmitthenner Mit.
-
Drei Westfalen in Heidelberg : Historische Persönlichkeiten aus dem Land der verlorenen Söhne
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
EUR 24,99
Währung umrechnenEUR 28,92 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Fachbuch aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Geschichte Europas - Mittelalter, Frühe Neuzeit, , Sprache: Deutsch, Abstract: In diesem Buch werden drei historische Persönlichkeiten vorgestellt: Sie lebten im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, stammten aus dem Hochstift Paderborn, einem westfälischen Fürstbistum, und wirkten in Heidelberg. Ihr interessanter Lebensweg wird hier anhand aufwendiger Quellenstudien erstmals ausführlich nachgezeichnet. Beim Ersten handelt es sich um Hermann von Höxter, einem der zeitlich allerersten Medizinprofessoren innerhalb der Grenzen des heutigen Deutschlands. Beim Zweiten geht es um Ludwig Dringenberg, der die frühhumanistische Pädagogik zuallererst an einer elsässischen Schule umsetzte und damit langfristig große Erfolge zeitigte. Der Dritte schließlich war Justus Reuber, ein Vorreiter auf verwaltungsjuristischem sowie historiographischem Gebiet, seines Zeichens Kanzler der Kurpfalz im Zeitalter des Konfessionalismus. Alle drei Persönlichkeiten haben als Bildungsmigranten Außerordentliches geleistet und sind heute dennoch weitgehend in Vergessenheit geraten. Dieses Buch soll ihr Leben und Wirken wieder in Erinnerung rufen und somit vor dem Vergessenwerden bewahren. Gleichzeitig soll mit dieser Publikation ein geschichtlicher Beitrag zur Entstehung des Nord-Süd-Gefälles innerhalb Deutschlands geleistet werden.
-
Das sanfte Gesetz in der Kunst in Sonderheit der Baukunst. Eine Rede. Die Rede wurde im Mai 1941 in der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau gehalten anläßlich der Verleihung des Erwin-v.-Steinbach-Preises der Johann wolfgang Goethe Stiftung an den Verfasser.
Verlag: Straßburg, Hüneburg,, 1943
Sprache: Deutsch
Anbieter: Göppinger Antiquariat, Göppingen, Deutschland
Signiert
EUR 175,00
Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorb23 x 16 cm, Broschur. 32 S. Einband berieben, bestoßen und stärker fleckig. Auf dem Vorsatz vom Verfasser signiert und handschriftlich gewidmet: "Christian+Waltraud Haller von Paul Schmitthenner Nov. 1943 4." Innen sauber. "Paul Schmitthenner (* 15. Dezember 1884 in Lauterburg im Elsass; 11. November 1972 in München) war ein deutscher Architekt und einflussreicher Hochschullehrer. Er zählt neben Paul Bonatz zu den Hauptvertretern der Stuttgarter Schule, der Heimatschutzarchitektur und - international gesehen - zur Architekturströmung des Traditionalismus. Schmitthenner wurde 1884 in Lauterburg im Elsass geboren. 1889 zog die Familie nach Barr im Elsass. Anschließend besuchte er das humanistische Gymnasium in Schlettstadt. Er studierte von 1902 bis 1907 Architektur an der Technischen Hochschule Karlsruhe und an der Technischen Hochschule München. Während seines Studiums wurde er Mitglied der Karlsruher Burschenschaft Ghibellinia. Bis 1909 arbeitete er beim Hochbauamt in Colmar (Elsass), von 1909 bis 1911 im Büro des Architekten Richard Riemerschmid in München. 1911 bis 1913 war er erstmals in selbstständiger Tätigkeit leitender Architekt der Gartenstadt Carlowitz bei Breslau. Von 1913 bis 1918 führte er, unterbrochen durch Kriegsdienst und Dienst beim Chef der Zivilverwaltung zur Organisation der Kurland-Schau", städtebauliche Planungen der Gartenstädte in Staaken, Plaue bei Brandenburg und Forstfeld bei Kassel für das Reichsamt des Inneren durch. Er machte dabei seit 1913 den Bau von Volkswohnungen" zu seinem Anliegen. Sein Konzept der Gartenstadt" überzeugte die Fachwelt durch besondere Qualitäten der räumlichen Anlage und der Hausformen. Der Wert des ebenerdigen Wohnens mit Arbeitsflächen und Ruhezonen im Garten wurde erkannt und herausgestellt. Schmitthenner publizierte in der Folgezeit vielfach über die deutsche Volkswohnung", die gesund und preiswert sowie mit handwerklich gut gestaltetem und kostengünstigem Mobiliar ausgestattet sein sollte. In seine Schriften flossen dabei sowohl bodenreformerische Thesen als auch erste Leitgedanken zum ökologischen Bauen seines Vorbildes Theodor Fischer mit ein. 1918 wurde er durch Paul Bonatz als Ordinarius (Professor) für Baukonstruktion und Entwerfen an die Technische Hochschule Stuttgart berufen. Zwischen den beiden Weltkriegen war er Vertreter der ersten" Stuttgarter Schule. 1928 war er Mitbegründer der Architektenvereinigung Der Block konservative Architekten im Unterschied zu dem 1924 von führenden Vertretern der Moderne gegründeten Der Ring. 1931 wurde er Ehrendoktor der Technischen Hochschule Dresden, Mitglied der Preußischen Akademie der Künste Berlin und der Akademie der bildenden Künste Wien sowie der Kunstakademie München. 1932 veröffentlichte Schmitthenner das Buch Das deutsche Wohnhaus". 1933 trat Schmitthenner der NSDAP bei und wurde nach Berlin berufen, wo er die Staatshochschule für Kunst leiten, eine Professur an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg innehaben und das Referat für Kunsterziehung im Reichsministerium besetzen sollte. Kurzzeitig galt er als erster Baumeister des nationalsozialistischen Staates, lehnte dann jedoch den Ruf ab und geriet in Opposition zur Partei. 1941 wandte er sich mit seinem kritischen Vortrag Das sanfte Gesetz in der Kunst, in Sonderheit in der Baukunst von der seinerzeit gängigen Monumentalarchitektur ab. 1944 siedelte er nach Zerstörung seines Wohnhauses auf dem Killesberg und der Technischen Hochschule Stuttgart in einen Seitenflügel von Schloss Kilchberg bei Tübingen um, wo er weiter universitäre Vorlesungen hielt. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs nahm ihn Adolf Hitler im August 1944 in die Gottbegnadeten-Liste der wichtigsten Architekten auf, was ihn von einem Kriegseinsatz, auch an der Heimatfront befreite. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er auf Befehl der amerikanischen Militärregierung aus dem Staatsdienst entlassen. 1947 wurde er vor einer Spruchkammer als Entlasteter freigesprochen, die Wiedereinsetzung in sein Hochschulamt scheiterte jedoch. Ab 1949 war Schmitthenner Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. 1952 ernannte man ihn zum Ehrenbürger seines Wohnorts Kilchberg bei Tübingen, im selben Jahr wurde ihm der Orden Pour le mérite für Wissenschaften und Künste verliehen. 1953 wurde er emeritiert, 1954 Ehrenmitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. 1955 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Technischen Hochschule Dresden erneut verliehen. 1964 erhielt er das Große Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland. Bedingt durch ein Augenleiden zog er 1971 zu seinem Sohn nach München, wo er im Folgejahr im Alter von 87 Jahren, zuletzt erblindet, starb. Schmitthenner war ab 1908 verheiratet mit Marie Charlotte geb. Schütz ( 1959) aus Barr; der Ehe entsprangen die zwei Söhne Martin ( 1940 in Frankreich) und Hansjörg sowie die Tochter Barbara. Nach dem Tod seiner ersten Ehefrau heiratete Schmitthenner 1960 Elisabeth Prüß aus Neustadt (Holstein) und hatte mit dieser einen weiteren Sohn, Johannes." (Wikipedia) Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1100.